Sektion: Transkulturelle Lebenswelten
Aktuell / Current Activities
Kontakt
Prof. Dr. Lisa Gaupp: gaupp@mdw.ac.at
PD Dr. Giulia Pelillo-Hestermeyer: giulia.pelillo@da-vienna.ac.at und https://www.da-vienna.ac.at/en/Faculty/Research-Area-Cultural-Studies
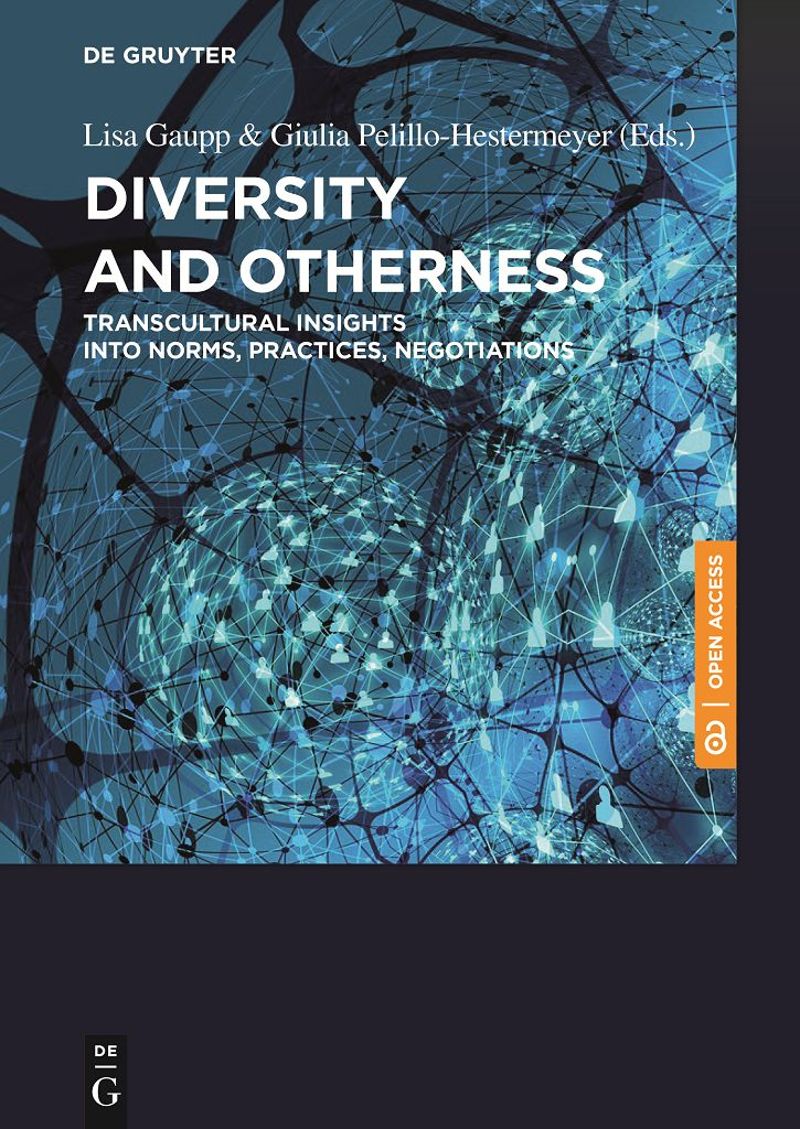
Published
Gaupp, Lisa & Pelillo-Hestermeyer, Giulia (eds.), Diversity and Otherness. Transcultural Insights into Norms, Practices, Negotiations. DeGruyter Open Berlin & Boston & Peking. https://doi.org/10.1515/9788366675308 Open Access: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9788366675308/html?lang=en
About this book
This book critically examines multiple ways in which cultural diversity is represented and handled in a variety of contexts, from the artistic to the scientific, from the political to the theatrical, in media, fashion and everyday life, today as well as in the past. By drawing from the observation that specific socio-cultural features are made relevant to create asymmetries and hierarchies between individuals, groups and cultural resources, the volume questions, on the one hand, contingent processes of regulation, standardization, and homogenization of diversity. It points at contradictory processes of in- and exclusion related to the construction of differences between the Self and the Other in processes of doing culture. On the other hand, it recognizes and emphasizes the fluidity of cultural entanglements by adopting a transcultural perspective, which unifies the variety of the topics and of the contexts covered by the chapters, as well as their inter- and transdisciplinarity. While processes such as globalization, decolonization, migration, and mediatization have contributed to place diversity at the centre-stage of both scholarly and non-scholarly debates, this book invites to re-think norms, practices and negotiations of diversity and otherness through a variety of narrations, standardizations, imaginations, and negotiations. By emphasizing the contrast between emancipatory vs. standardizing approaches to diversity and otherness it also invites to “transculturalize” the study and the politics of culture.
Kurzbeschreibung / About
The section „Transcultural Lifeworlds“ aims to promote and strengthen collaborations between scholars and practitioners (artists, media makers, teachers, etc.) who work on diversity, transculturality, decoloniality, as well as on all fields in which socio-cultural features are made relevant to create power asymmetries and generate inequalities.
We understand transculturality both as a theoretical framework and as a method which enable us to question static categorizations such as the West vs. the East, tradition vs. modernity, male vs. female, and to develop alternative maps and narratives across and beyond such distinctions. The broad formulation „Lifeworlds“ as an object of research has been deliberately chosen to include a variety of contexts, from the scientific to the artistic, from the political to the theatrical, in media, education and everyday life. The critique of power, as well as the development of more equal cultures of conviviality, are at the core of our engagement.
The section „Transcultural Lifeworlds“ has contributed to the activities of the KWG from its very foundation with a variety of activities that have developed transcultural perspectives upon issues raised by the annual conferences and beyond (s. archive). Some of these contributions appear in the edited volume Diversity and Otherness. Transcultural Insights into norms, practices, negotiations.
Researchers and practitioners interested in participating in the activities of the section are very welcome to get in touch with the speakers of the section.
Konzeptpapier
Kulturaustauschprozesse wurden lange Zeit und werden noch heute häufig anhand statischer, homogener Kategorien (z. B. die deutsche oder westliche Kultur im Gegensatz zur chinesischen oder östlichen) konzeptualisiert und erforscht. Ohne bestreiten zu wollen, dass auch solche Denkmuster in kulturellen Begegnungen eine bedeutende Rolle spielen können, ist das Hauptziel der Sektion, über solche etablierte Kategorien hinaus Fragen der kulturellen Hybridisierung in inter- und transdisziplinärem Austausch zu behandeln. Transkulturalität verstehen wir dabei einerseits als theoretische Perspektive auf zeitgenössische und historische Gesellschaftsprozesse, welche zuvorderst Verflechtungen sowie Vernetzungen in den Fokus nimmt. Andererseits bietet eine transkulturelle Perspektive, verstanden als methodologisches Analyseinstrumentarium, die Möglichkeit, Fragestellungen der Dekonstruktion der genannten und weiterer etablierter Zuschreibungskategorien zu erörtern.
‚Transkulturalität‘ (im deutschen Sprachraum v. a. von Wolfgang Welsch in die Debatte eingeführt) scheint neben Begriffen wie Diversität, Kreolisierung, Transnationalismus, Hybridität oder super diversity ein neues Trendkonzept kulturwissenschaftlicher Forschung zu sein. Alle diese Konzepte beruhen auf der Annahme, dass die großen Narrativen der Moderne dekonstruiert wurden, und dass, wenn überhaupt, ein Diskurspluralismus im Sinne der Postmoderne auszumachen sei. Das Thema ‚transkulturelle Lebenswelten‘, häufig mit Alternativbegriffen wie ‚interkulturelle Projekte‘ o. ä. verwechselt, kam im vergangenen Jahrzehnt vermehrt auch auf die politische Agenda und damit auch in die öffentliche Debatte. In dieser öffentlichen Debatte, die sich vor allem um Migrationszusammenhänge dreht, wird meist eine Identität zwischen topografischer Herkunft und Kulturzugehörigkeit vorgenommen.
Die Auseinandersetzung mit Hybridisierung und Diversität soll bei der Sektionsarbeit insbesondere die damit zusammenhängenden konfliktären Artikulationen hervorheben. Hierbei sind sowohl inter- als auch transkulturelle Zugänge von Bedeutung, wobei Trans- und Interkulturalität nicht als synonym gelten: Während Interkulturalität von der Getrenntheit verschiedener Kulturen bei kulturellen Begegnungen ausgeht, impliziert Transkulturalität eine Vielfalt hybrider Praktiken, die eine Transformation der ‚ursprünglichen‘ Kulturen impliziert, bei der manches aufgenommen und manches zurückgewiesen wird. Die bei einem solchen Verständnis aufkeimende Frage zur Begrenztheit vom Transkulturalitätskonzept (entweder werden weiterhin ‚Ursprungskulturen‘ impliziert oder ‚es ist und war immer schon alles vermischt‘) wird in der Sektionsarbeit bearbeitet. Es soll hier betont werden, dass Hybridisierung nicht ausschließlich als gegenwärtiger Prozess im Rahmen der Globalisierung zu verstehen ist, sondern vor allem eine Betrachtungsperspektive darstellt, welche u. a. Konzepte von ‚Authentizität‘, ‚Ursprungskultur‘ oder ‚Nationalkultur‘ kritisch hinterfragt und somit Geschichtsschreibungen einer Revision unterziehen möchte. Dementsprechend sind historische Perspektiven, auch hinsichtlich einer longue durée oder Konzepten wie ‚histoire croisée‘ oder ‚entangled history‘ ebenfalls angesprochen.
Ebenso ist das Feld der „Forschungsgegenstände“ bewusst weit gefasst, um der Komplexität von Transkulturalität Genüge zu tun. Es kann dabei jegliche Phänomene verschiedener Lebenswelten in synchroner und/oder diachroner Perspektive umfassen, die von alltagskulturellen, über künstlerische bis hin zu verschiedenen weiteren politischen und gesellschaftlichen Feldern reichen können. In diesem Zusammenhang stehen folgende Schwerpunkte im Fokus des Interesses: die Frage über die Zukunft des Postkolonialismus und des Postmigrantischen; die Anwendung von Konzepten wie Cultural Flows, Hybridity, Kulturosmose und generell die Reflexion über transkulturelle Ansätze. Ein transkultureller Ansatz berücksichtigt bei der Kulturanalyse die Dynamiken zwischen ‚Globalem‘ und ‚Lokalem‘ in der Vielfalt derer Ausdrucksformen. Hierbei erscheinen sowohl konkrete Praktiken (z. B. Musikstile oder Kommunikationsformen) als auch verbreitete Ideen und Stereotype als Lebenswelten, die im Fokus des Interesses der Sektion stehen.
Transkulturelle Lebenswelten sind keineswegs als homogene Lebenswelten im Sinne eines ‚globalen Dorfs‘ zu verstehen. Wenn man zum Beispiel die aktuelle Diskussion über Grenzen und Chancen der Diversität in Europa berücksichtigt, fällt auf, wie diese je nach Kontext als „Problem“ oder als „Potential“ für (europäische) Gesellschaften dargestellt wird. Wenn über Diversität im Zusammenhang mit Migration und Einwanderung diskutiert wird, wird über physische sowie soziokulturelle Grenzen der ‚Solidarität‘ verhandelt, wobei sich bei der Definition der Gruppe, in der Solidarität herrschen sollte, lokale, nationale, europäische und globale Perspektiven überschneiden und häufig in Konflikt geraten.
Die Sektion „Transkulturelle Lebenswelten“ soll zur Intensivierung der Kooperation über die traditionellen fachlichen Grenzen hinaus beitragen (s. u.), denn Themen der Transkulturalität, der Hybridisierung, der Globalisierung und der Diversität werden in allen kulturwissenschaftlichen Fachdisziplinen diskutiert, größtenteils unter Anwendung ähnlicher Theorielinien. Beispielsweise werden ‚globalisierte künstlerische Praktiken‘ in der Literaturwissenschaft, in der Soziologie, in der Kunstwissenschaft, in den Musikwissenschaften oder Theaterwissenschaften behandelt. Daher versteht sich die Sektion als Ort, der sowohl das Gemeinsame als auch das Gegensätzliche dieser verschiedenen disziplinären Perspektiven auf ein Transkulturalitäts-Thema herausarbeitet. Eine weitere Brücke, die durch die Sektionsarbeit geschlagen werden soll, betrifft die Kooperation zwischen ForscherInnen und PraktikerInnen z. B. in Form von gezielten Workshops.
Derzeit sind die primären Themenschwerpunkte der Sektion: die Transformation von Konzepten Europas im Kontext der gegenseitigen Wirkung inner- und außereuropäischer Perspektiven; glokale Dynamiken; Migration, Diaspora und Exil; Politiken der Diversität; Inszenierungen von Transkulturalität in den Künsten; Gender und Intersectionality; Identität und Alterität. Synergien und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit haben sich im Dialog mit anderen Sektionen gezeigt, insbesondere mit Raumidentitäten/Identitätsräumen, Mixed Methods, Wissenskulturen, Kulturen/Naturen, Historische Anthropologie, Sprache und kommunikative Praktiken. Die Sektion „Transkulturelle Lebenswelten“ strebt darüber hinaus auch den internationalen wissenschaftlichen Austausch an und wird daher als Arbeitssprachen neben dem Deutschen auch das Englische und bei Bedarf andere Sprachen nutzen.
Bei der Jahrestagung 2016 an der Universität Vechta war das Thema der Sektion „Diversität à l’européenne zwischen Standards und Lebenswelten“. Hier finden Sie den Bericht über die Sektionsarbeit.
Auf der Jahrestagung im November 2017 in Gent, Belgien veranstaltet die Sektion am Samstag, den 18.11.2017 von 9:00-11:30 Uhr ein Panel (Nr. 20) zum Thema „Diversity and Otherness in Corpo-realities“. Hier finden Sie die Abstracts der Vortragenden. Im Anschluss organisiert die Sektion einen Workshop (11:30-13:00 Uhr) im Hinblick auf eine geplante Publikation zum Thema „Diversity and Otherness between Standards and Life-Worlds“.
Am 12.10.2018 findet im Rahmen der 4. Jahrestagung der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft „Ästhetische Praxis und kulturwissenschaftliche Forschung“, Hildesheim (11.-13.10.2018), ein gemeinsames Panel der KWG-Sektionen Kulturwissenschaftliche Border Studies und Transkulturelle Lebenswelten unter dem Titel „Ästhetiken der Grenze in transkulturellen Räumen und Lebenswelten“ statt. Weitere Informationen können Sie dem Call for Papers (Deutsch und Englisch) entnehmen. Vortragsvorschläge können noch bis zum 30.07.2018 eingereicht werden.
Bei der KWG-Jahrestagung „B/ordering Cultures“ (08.-10.10.2020) in Frankfurt/Oder fand das Panel “(B)ordering Race, Nation, Diversity” statt; das Panel-Programm inklusive der Abstracts finden Sie hier.
Archiv
- 2022 Section Panels “Trans-Species Collaborations: Social Climate Change & New Cultures of Care” and “Translating Cultural Studies: Research, Networks, Publishing” at the 7th Annual Conference „Posthumanismus. Jenseits des Menschen?“ at Karl-Franzens-University Graz
- 2020 Section Panel “(B)ordering Race, Nation, Diversity” at the the 6th Annual Conference B/ORDERING CULTURES: Everyday Life, Politics, Aesthetics at European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
- 2019 Section Panel “Diversität in Organisationen: Kulturwissenschaftliche Zugänge zu Normen, Verhandlungen und Praktiken“ at the 5th Annual Conference at University of Koblenz-Landau
- 2018 Section Panel (jointly organized with the section Kulturwissenschaftliche Border Studies) “Ästhetiken der Grenze in transkulturellen Räumen und Lebenswelten“ at the 4th Annual Conference Ästhetische Praxis und kulturwissenschaftliche Forschung at University of Hildesheim
- 2017 Section Panel “ Diversity and Otherness in Corpo-realities” at the 3rd Annual Conference Bodies in Motion at University of Ghent
- 2016 Section Panel “Diversität à l’européenne zwischen Standards und Lebenswelten“ at the 2nd Annual Conference Migration und Europa in kulturwissenschaftlicher Perspektive at University of Vechta
- 2015 Section Panel “Trancultural Life Worlds” at the 1st Annual Conference Ansichten einer künftigen Kulturwissenschaft at Leuphana University of Lüneburg
- 2015 Concept paper of the section
